
Gedenktag
Heute vor 123 Jahren kam Paula Haushahn zur Welt. Sie war Schorndorfs erste Lokaljournalistin. 1888 hatte ihr Vater, der Buchdruckereibesitzer Adolf Haushahn, die demokratische Zeitung „Schorndorfer Volksblatt“ gegründet, für das sie Berichte verfasste und als Anzeigenleiterin fungierte.
Als Haushahns Verlag samt Buchdruckerei im Jahr 1940 von der NS-Presse übernommen wurde, musste sie ihren Lebensunterhalt gezwungenermaßen beim „Schorndorfer Kreisblatt“ verdienen. Beachtlich ist, dass sie dort dem Verlagsleiter Viktor Mathioszek, der nach ihren Aussagen ein „typischer Nazi mit dem goldenen Parteiabzeichen“ war, in der Geschäftsstelle Hausverbot erteilte, und ihn schließlich aus seinem Amt vertrieb. Und dies, obwohl der Schriftleiter der Zeitung, Dr. Böhmer, „nie gewagt hat, ihm die Türe zu weisen, auch wenn er ihn noch so beleidigt und gequält hat“.
„In einem Elternhaus erzogen, in dem die Gedanken von Völkerverständigung und Demokratie im ständigen Kampf gegen konservative und alldeutsche Kreis verfochten wurden, kam ich schon sehr frühe mit der Politik in Berührung und habe mich mit Leidenschaft den Ansichten meines Vaters zugewandt“, schreibt Paula Haushahn 1946 an die Spruchkammer, die über ihre Rolle im Dritten Reich zu urteilen hatte. „Es ist auch nicht so, dass ich den Nationalsozialismus nur bis zum Jahre 1933 mit den mir zu Gebote stehenden Mitteln bekämpft habe. Ich habe auch nach 1933 überall, wo es mir möglich war, meine Meinung offen ausgesprochen.“
Seit Sommer 1937 habe sich ihr „Widerstreben gegen den Nationalsozialismus auf eine Person verdichtet, den Verlagsleiter des ‚Schorndorfer Kreisblatt‘ Mathioszek“. Dieser „war Blutordensträger (mit handschriftlich geschriebener Postkarte Hitlers) und jeder, der weiss, wie sich dieser Mann hier gebärdet und mit welcher Machtglorie er sich umgeben hat, kann ermessen, dass ich doch immerhin einigen Mut aufgebracht habe, gegen ihn Stellung zu nehmen und zu erwirken, dass er die Geschäftsstelle Schorndorf nicht mehr betreten durfte“.
In die NS-Frauenschaft sei sie 1936 nur auf Wunsch ihres Bruders eingetreten, um „gewisse Beziehungen zu den Gliederungen der Partei“ aufzubauen, und zwar „im Interesse der Erhaltung unseres ‚Volksblatt‘ – das doch immerhin für viele ein letzter Hort alter rechtlicher Denkart war – um dem Ansturm der NS-Presse gegenüber Stand halten zu können.“ Sie erklärt: „Ich hätte auch von mir aus niemals freiwillig unser ‚Volksblatt‘ der NS-Presse übergeben und es war der schwerste Entschluss meines Lebens, die mir angebotene Stellung bei der gehassten Konkurrenz anzunehmen“.
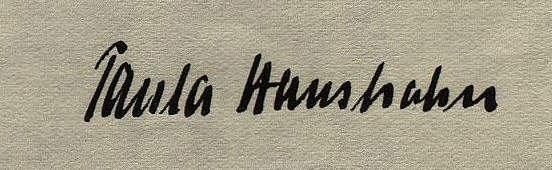
Bei ihrer Übernahme hatte sie vor Zeugen „ausdrücklich erklärt“, für diese Zeitung keine Berichte verfassen zu wollen. „In der Praxis hat sich aber gezeigt, dass über vieles, was die Schorndorfer bewegt hat, nichts in der Zeitung gekommen wäre, wenn ich nicht selbst darüber geschrieben hätte. Vor allem nach der Zusammenlegung der Zeitungen im Kreis Waiblingen zur „Waiblinger Kreiszeitung“ wäre Schorndorf gegenüber Waiblingen und Welzheim sehr benachteiligt gewesen“, schreibt sie in ihrer Stellungnahme. „Deshalb habe ich die Lokalberichterstattung übernommen und später meine Schriftleiterprüfung gemacht. – Politische Leitartikel oder politische Lokalspitzen habe ich weder für das ‚Schorndorfer Kreisblatt‘ noch für die ‚Waiblinger Kreiszeitung‘ geschrieben.“
Die Spruchkammer stufte sie im Februar 1947 als „Mitläuferin“ ein. Der ebenfalls aus Schorndorf stammende Befreiungsminister Gottlob Kamm ordnete jedoch drei Monate später die Aufhebung des Urteils an: „Da die Betroffene in der Frauenschaft das Amt einer Blockleiterin bekleidet hat und da sie ausserdem der Reichspressekammer angehört hat und von 1941 an als Geschäftsführerin der Waiblinger Kreiszeitung tätig war, erscheint ihre Tätigkeit als eine mehr als unwesentliche Unterstützung des Nationalsozialismus“.
Dem hielt der von Paula Haushahn beauftragte Rechtsanwalt Wolfgang Haußmann entgegen, dass sie nie Mitglied in der NSDAP war und meinte: „Dass sie den Verlockungen der Partei und ihren Drohungen zugleich Widerstand geleistet hat, während Tausende und Abertausende unter gleichen Umständen umgefallen sind, beweist schlagend ihre demokratische Grundhaltung.“ Hinsichtlich ihres Eintritts in die NS-Frauenschaft argumentierte er, dass die Partei es „sehr geschickt verstanden“ habe, dieser Organisation „nach aussen hin einen fürsorgerischen, caritativen und rein kulturellen Charakter zu geben.“ Zudem hätten viele Frauen, „die innerlich völlig ablehnend dem Nationalsozialismus gegenüberstanden“, die Mitgliedschaft dort gewählt, als „ein treffliches Mittel, um der Parteimitgliedschaft zu entgehen“.
Am 29. September 1947 wurde das Verfahren gegen Paula Haushahn aufgrund der „Weihnachts-Amnestie vom 5.2.1947“ eingestellt. Mit dem abschließenden Urteil: „Sie gilt daher als vom Gesetz nicht betroffen.“
Paula Haushahn leitete von 1948 bis 1966 die Geschäftsstelle der Neuen Württembergischen Zeitung (NWZ) am Oberen Marktplatz und erhielt lebenslang 10 Prozent des Inserentenumsatzes, weil sie dort ihre früheren Abonnenten eingebracht hatte. Sie starb am 11. Februar 1989, einen Monat nach ihrem 90. Geburtstag. In seinem Nachruf bescheinigte ihr der Redaktionsleiter Hans Peter Burchard: „Die damaligen Schorndorfer Nachrichten der NWZ gewannen unter ihrer Führung an Bedeutung und Ansehen.“ Dass sie es erreicht hatte, den NS-Mann Mathioszek aus der Schorndorfer Geschäftsstelle der Zeitung zu vertreiben, hat Paula Haushahn nach eigener Aussage zeitlebens befriedigt.

